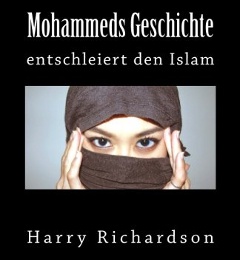| Datei: | vds2.php |
| Erstellt: | 29.12.2011 |
| Aktualisiert: | 29.12.2011 |
Vorratsdatenspeicherung II.
Am 27.12.2011 verstrich die verlängerte Frist der EU zur Umsetzung der
Direktive
2006/24/EG zur Vorratsdatenspeicherung (VDS) und Deutschland droht nun also ein Verfahren vor dem europäischen
Gerichtshof. Deshalb ist die VDS aktuell wieder ein Thema in der Politik, denn das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hatte die in der Zeit vom 01.01.2008 bis 2010 bestehende Regelung im März 2010 für
verfassungswidrig erklärt. Seither wurde kein neues Gesetz verabschiedet.
zur Vorratsdatenspeicherung (VDS) und Deutschland droht nun also ein Verfahren vor dem europäischen
Gerichtshof. Deshalb ist die VDS aktuell wieder ein Thema in der Politik, denn das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hatte die in der Zeit vom 01.01.2008 bis 2010 bestehende Regelung im März 2010 für
verfassungswidrig erklärt. Seither wurde kein neues Gesetz verabschiedet.
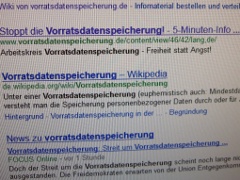 Die zuständige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger findet die anlasslose Speicherung
von Telekommunikations- Verbindungsdaten aller Bürger unverhältnismäßig und möchte deshalb
das Ergebnis einer ohnehin anstehenden Überprüfung der EU-Richtline abwarten. Eine vernünftige
Einstellung, denn immerhin hat das BVerfG die einst bestehende Regelung nicht ohne Grund
verworfen. Und es gibt Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise Rumänien,
die die anlasslose Speicherung dieser Daten als Menschenrechtswidrig eingestuft, und die Umsetzung
der Richtlinie deshalb zurecht verweigert haben. Auch Deutschland hätte die Umsetzung der VDS
verweigern können, wenn das BVerfG zu der Überzeugung gekommen wäre, daß die Richtlinie gegen
das Grundgesetz verstosse. Jedoch hat das BVerfG entschieden, daß die VDS unter bestimmten
Voraussetungen grundsätzlich mit der Verfassung zu vereinbaren wäre. Der irische High
Court hat sich mit Urteil vom 05.05.2010 hingegen dazu entschieden, dem EU-Gerichtshof die
Frage vorzulegen, ob die Richtline 2006/24/EG gegen die Ende 2009 in Kraft getretene
EU-Grundrechtecharta verstößt. Es macht durchaus Sinn, das Ergebnis abzuwarten.
Die zuständige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger findet die anlasslose Speicherung
von Telekommunikations- Verbindungsdaten aller Bürger unverhältnismäßig und möchte deshalb
das Ergebnis einer ohnehin anstehenden Überprüfung der EU-Richtline abwarten. Eine vernünftige
Einstellung, denn immerhin hat das BVerfG die einst bestehende Regelung nicht ohne Grund
verworfen. Und es gibt Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise Rumänien,
die die anlasslose Speicherung dieser Daten als Menschenrechtswidrig eingestuft, und die Umsetzung
der Richtlinie deshalb zurecht verweigert haben. Auch Deutschland hätte die Umsetzung der VDS
verweigern können, wenn das BVerfG zu der Überzeugung gekommen wäre, daß die Richtlinie gegen
das Grundgesetz verstosse. Jedoch hat das BVerfG entschieden, daß die VDS unter bestimmten
Voraussetungen grundsätzlich mit der Verfassung zu vereinbaren wäre. Der irische High
Court hat sich mit Urteil vom 05.05.2010 hingegen dazu entschieden, dem EU-Gerichtshof die
Frage vorzulegen, ob die Richtline 2006/24/EG gegen die Ende 2009 in Kraft getretene
EU-Grundrechtecharta verstößt. Es macht durchaus Sinn, das Ergebnis abzuwarten.
Das Verstreichen der Frist am 27.12.2011 wird von den Befürwortern der VDS nun zum willkommenen
Anlaß genommen, wieder einmal lautstark auf die Wiedereinführung der VDS zu drängen. Aber auch,
um die zögernde Bundesjustizministerin in den Medien öffentlich des Rechtsbruchs zu beschuldigen.
Es verstoße gegen geltendes Recht, die EU-Richtlinie nicht umzusetzen, so Bosbach und Uhl und
sie tun dabei so, als wäre die Nichtumsetzung der Richtlinie eine schwerwiegende und einzigartige,
nicht hinnehmbare Verfehlung innerhalb der EU. Das soll wohl in der Bevölkerung Empörung auslösen
und das Ansehen der tapferen Justizministerin beschädigen. Daß dies der gezielte Versuch der
Verunglimpfung der Person Leutheusser-Schnarrenberger ist, zeigt sich unter anderem darin,
daß die Herren Bosbach und Uhl in ihren öffentlichen Beschuldigungen verschweigen, daß es
in Deutschland sozusagen Gang und Gäbe ist, EU-Richtlinen und Vorgaben nicht umzusetzen,
die der hiesigen Politik nicht in den Kram passen. Selbst drohende Strafzahlungen werden dabei
in Kauf genommen. So sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels über
20
 Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anhängig (siehe Seite 17). Eine unvollständige
Auflistung gibt es
hier
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anhängig (siehe Seite 17). Eine unvollständige
Auflistung gibt es
hier
 .
.
Wenn Deutschland die EU Richtlinie 2006/24/EG also vorerst nicht umsetzt, ist das keinesfalls ein so außerordentlicher Vorgang, wie uns die Unionspolitiker gerne weiß machen wollen. Im Gegenteil. Wenn man gleichzeitig betrachtet wie sehr diese Herren die VDS herbeiwünschen, entlarvt sich das systematische Verschweigen der ganzen Wahrheit als gezielte Desinformation. Nicht die Nichtumsetzung der Richtlinie ist also der Skandal, sondern die Art und Weise, wie Unionspolitiker versuchen, die öffentliche Meinung durch einseitige und falsche Darstellung von Tatsachen zu manipulieren.
Dazu gehört auch, daß Unionspolitiker immer wieder versuchen, die VDS als als eine Idee der EU zu verkaufen. Das ist ein glatte Lüge und daher Grund genug, einmal das Zustandekommen der EU-Richtline zu beleuchten. Denn tatsächlich ist die EU-Richtlinie das Ergebnis vornehmlich deutscher Bestrebungen:
Im Jahr 1996 legte die Bundesregierung den Entwurf für ein neues Telekommunikationsgesetz vor. Die Innenminister der Bundesländer nutzen die Gunst der Stunde und versuchten schon damals eine VDS einzuführen. In der Stellungnahme des Bundesrates forderten sie, neben einer Höchst- auch eine Mindestspeicherdauer von Telekommunikations- Verbindungsdaten im Gesetz festzulegen. Das war die Geburtsstunde der Idee einer VDS. Hier in Deutschland.
Der Bundesrat scheiterte aber, denn die Bundesregierung sah in der Festschreibung einer Mindestspeicherdauer eine unzulässige Speicherung von Daten auf Vorrat. Und hier taucht auch erstmals der Begriff der Vorratsdatenspeicherung auf. Mit der Ablehnung durch die damalige Bundesregierung wäre die VDS eigentlich vom Tisch gewesen. Aber die Konferenz der Innenminister forderte in einem Beschluss am 24.11.2000 erneut, die VDS einzuführen. Wieder erfolglos. Nach den Terroranschlägen in den USA witterten die Innenminister eine gute Chance und die Länder Bayern und Thüringen legten einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des strafrechtlichen Instrumentariums vor, der wieder eine VDS enthielt. Der Entwurf wurde am 22.03.2002 mit der Mehrheit im Bundesrat abgelehnt. Hartnäckig, wie die Befürworter dieser Idee sind, haben sie es schließlich so gemacht, wie kleine Kinder es tun. Wenn Mama nein sagt, geht man zu Papa und versucht es eben dort. Und so wurde die Idee der VDS von deutschen Politikern(!) nach Brüssel getragen und dort massiv voran getrieben.
 Der Haken dabei war jedoch, daß sich die EU eigentlich nicht in die innere Sicherheit
der Mitgliedsstaaten einmischen darf. Also hat man die VDS kurzerhand zu einer notwendigen
Maßnahme zur „Harmonisierung“ in der EU erklärt. Das Argument war, die Anbieter von
Telekommunikations-dienstleistungen müßten aus Wettbewerbsgründen in der ganzen EU gleiche
Bedingungen vorfinden, wozu auch die Dauer der Datenspeicherung geregelt werden müsse. Auch
hier zeigt sich die Hartnäckigkeit und Dreistigkeit der Befürworter der VDS, denn das Argument,
die Speicherdauer müsse aus Wettbewerbsgründen harmonisiert werden, ist nur zu leicht als ein
billiger Trick zu durchschauen. Jedem auch nur halbwegs klar denkendem Mensch dürfte klar sein,
daß die Verpflichtung zur Speicherung von Telekommunikations-Verbindungsdaten auf Vorrat
nur einer Sache dient, nämlich der Strafverfolgung und damit eine Angelegenheit der inneren
Sicherheit der jeweiligen Mitgliedsstaaten ist.
Der Haken dabei war jedoch, daß sich die EU eigentlich nicht in die innere Sicherheit
der Mitgliedsstaaten einmischen darf. Also hat man die VDS kurzerhand zu einer notwendigen
Maßnahme zur „Harmonisierung“ in der EU erklärt. Das Argument war, die Anbieter von
Telekommunikations-dienstleistungen müßten aus Wettbewerbsgründen in der ganzen EU gleiche
Bedingungen vorfinden, wozu auch die Dauer der Datenspeicherung geregelt werden müsse. Auch
hier zeigt sich die Hartnäckigkeit und Dreistigkeit der Befürworter der VDS, denn das Argument,
die Speicherdauer müsse aus Wettbewerbsgründen harmonisiert werden, ist nur zu leicht als ein
billiger Trick zu durchschauen. Jedem auch nur halbwegs klar denkendem Mensch dürfte klar sein,
daß die Verpflichtung zur Speicherung von Telekommunikations-Verbindungsdaten auf Vorrat
nur einer Sache dient, nämlich der Strafverfolgung und damit eine Angelegenheit der inneren
Sicherheit der jeweiligen Mitgliedsstaaten ist.
Gerade weil dieser Trick so offensichlich war, strengte Irland im Jahr 2006 eine Klage beim EuGH an (Az.C-301/06), um feststellen zu lassen, ob die EU überhaupt das Recht hatte, eine solche Regelung auf dieser Basis zu erlassen. Die Klage scheiterte jedoch wie zu erwarten, denn man hätte ja sonst die arglistige Definitionsverdrehung einräumen müssen.
Wenn uns Unionspolitiker heute also sagen, die Richtlinie käme aus der EU und müsse umgesetzt werden, dann ist auch das nur die halbe Wahrheit. Die Idee einer anlasslosen Speicherung von Telekommunikations- Verbindungsdaten unschuldiger Bürger auf Vorrat ist die Idee deutscher Politiker, die hier zunächst scheiterten und dann den Umweg über Brüssel genommen haben.
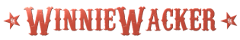
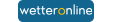
 Android-Handy
Android-Handy