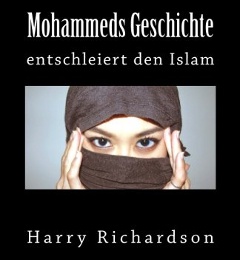| Datei: | doc232.php |
| Erstellt: | 08.08.2009 |
| Aktualisiert: | 22.11.2011 |
Sicherheit versus Freiheit

Spricht man Herrn Schäuble auf seine freiheitseinschränkenden Gesetze an, so wiederholt er gebetsmühlenartig, daß es eine Freiheit ohne Sicherheit nicht geben könne und umgekehrt. Daß Sicherheit die Vorraussetzung für Freiheit wäre und sich die beiden gegenseitig bedingen würden. Ich glaube nicht, daß er selbst an diese unsinnige These glaubt, denn zu einfach läßt sie sich widerlegen. Aber leider scheint es so zu sein, daß viele seiner Parteifreunde und große Teile der Bevölkerung sich mit dieser philosophisch anmutenden Rhetorik abspeisen lassen und sich nicht einmal die Mühe machen, sie zu hinterfragen. Grund genug, mit diesem Unsinn endlich aufzuräumen.
Sehr geehrter Herr Schäuble,
Freiheit und Sicherheit bedingen einander nicht, sondern schließen sich sogar gegenseitig aus. Wer sicher ist, kann nicht frei sein und wer frei ist, kann nicht sicher sein. Es sind zwei Pole, die man nicht gleichzeitig einnehmen kann. Man kann sich zwar beliebig zwischen ihnen bewegen, aber sie bedingen einander nicht. Jeder Schritt in Richtung Sicherheit bedeutet, daß man sich von der Freiheit entfernt. Und umgekehrt. Diese einfache Erkenntnis ist so klar und einleuchtend, daß man wahrhaftig an der Intelligenz jener Menschen zweifeln muß, die Ihnen diesen Quatsch glauben, Herr Schäuble.
Vielleicht meinen Sie damit, daß es in unserer Gesellschaft weder die völlige Freiheit, noch die absolute Sicherheit geben könne. Daß es eine Abwägung geben müsse, wo sich unsere Gesellschaft zwischen den Polen Freiheit und Sicherheit positioniert. Wenn Sie das meinen, dann sagen Sie es doch bitte auch so. Aber dann müßten Sie ja einräumen, daß jedes neue Sicherheits- und Überwachungsgesetz gleichzeitig eine weitere Einschränkung der Freiheit bedeutet. Und das zuzugeben, fällt Ihnen offensichtlich so schwer, daß Sie lieber diesen Unsinn verbreiten und die Menschen für dumm verkaufen.
Indem Sie sich immer wieder hinstellen und behaupten, Ihre Gesetze würden zwar mehr Sicherheit schaffen, die Freiheit aber nicht berühren, betreiben Sie die vorsätzliche Desinformation.

Um nur ein Beispiel aufzugreifen behaupten Sie, daß die Vorratsdatenspeicherung keines einzigen Menschen Freiheit beeinträchtgen würde. Man könne sich so frei und unbefangen verhalten, wie man es ohne die massenhafte Protokollierung der Verbindungsdaten konnte.
Doch Sie wissen selbst, daß das nicht stimmt. Nehmen Sie ein Beispiel, das eigentlich jedes Kind versteht: Würden Sie sich denn nicht deutlich anders verhalten, wenn sich eine Kamera in Ihrer Wohnung befände und Sie Kenntnis davon hätten? Dabei wäre es völlig egal, ob die Kamera aktiv ist und ob Sie tatsächlich gerade beobachtet würden. Denn da Sie das nie wissen könnten, würden Sie sich ständig so verhalten, als würden Sie gerade überwacht. Die Kamera würde zwar nicht unmittelbar Ihre Freiheit einschränken, jedoch würde sie Sie dazu bringen, ihre Freiheit selbst einzuschränken (Panoptismus).
Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es nicht anders. Die Einschränkung der Freiheit und damit der Grundrechtseingriff findet keineswegs erst dann statt, wenn der Staat tatsächlich im Einzelfall die Daten kontrolliert, sondern bereits mit der Erhebung dieser Daten. In dem Wissen, daß sein Kommunikationsverhalten gespeichert wird und jederzeit abgerufen und vielleicht gegen ihn verwendet werden könnte, ändert der Bürger sein Kommunikationsverhalten, indem er es auf unverfängliche, unauffällige und belanglose Kommunikation reduziert und sogar bestimmte Worte und Phrasen vermeidet, die ihn verdächtig machen könnten. Das ist nicht nur eine leichte Einschränkung der Freiheit, sondern ein ganz erheblicher Eingriff in die Grundrechte aller Menschen!
Die Verfassung ist immer weniger das Gehege, in dem sich demokratisch legitimierte
Politik entfalten kann, sondern immer stärker die Kette, die den Bewegungsspielraum
der Politik lahmlegt.
Wolfgang Schäuble, September 1996
Ich fürchte, daß Herr Minister Schäuble den Blick für die Realität verloren hat.
Er respektiert nicht den Geist der Verfassung, sondern testet ihre Belastbarkeit.
Burkhard Hirsch, Mai 2007
Bei der Vorratsdatenspeicherung wird von ausnahmslos allen Bürgern gespeichert, wann sie mit wem wie lange auf elektronischem Wege kommuniziert haben und wo sie sich dabei gerade aufgehalten haben. Da es keinen Unterschied macht, ob man auf elektronischem, direktem oder auf schriftlichem Weg miteinander kommuniziert, ist die Tiefe des Grundrechtseingriffs nicht geringer, als würde hinter jedem Bürger ein Privatdetektiv herlaufen, der im Auftrag des Staates von jedem Bürger notierte, wann er mit wem und wie lange auf der Straße redet und wo genau das stattfindet. Nur weil die Protokollierung der elektronischen Kommunikation äußerst einfach und relativ preiswert zu machen ist, ändert das an der Tiefe des Grundrechtseingriffes nichts!
Umgekehrt wird der Grundrechtseingriff nicht dadaurch tiefer, daß das ständige Beobachten der unmittelbaren Kommunikation durch Detektive extrem teuer und aufwändig wäre. Die Tiefe des Grundrechtseingriffs ist also absolut identisch, egal ob die elektronische oder die unmittelbare Kommunikation protokolliert wird. Die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit hat widerum nichts mit dem Aufwand zu tun, der für den Grundrechtseingriff betrieben werden muß, sondern ausschließlich mit der Tiefe des Grundrechtseingriffs im Verhältnis zum Ziel, das damit erreicht werden soll. Einfacher ausgedrückt ist die Verdachts- und ereignislose Protokollierung der Verbindungsdaten aller Bürger ebenso verhältnismäßig oder unverhältnismäßig, wie die ständige verdachts- und ereignislose Beobachtung aller Bürger durch staatlich beauftragte Privatdetektive auf der Straße!
Ich möchte zum Anfang dieser Webseite zurückkommen, wo es um die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit ging und Ihnen für diese Abwägung eine kleine Hilfe an die Hand geben. So heißt es in der deutschen Nationalhymne keineswegs „Einigkeit und Recht und Sicherheit“, sondern nach wie vor „Einigkeit und Recht und Freiheit“. Das sollte Ihnen helfen, die Prioritäten wieder richtig zu justieren.
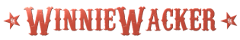
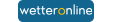

 Android-Handy
Android-Handy